Zwei unterschiedliche Bereiche – ja und nein
„Was soll das?“, werden Sie sich vielleicht fragen. „Man kann doch nicht Äpfel mit Birnen vergleichen.“ Natürlich nicht! Aber mitunter gibt es Gemeinsamkeiten bei entfernt anmutenden Bereichen, genau wie bei Äpfeln und Birnen. Beide Obstsorten bilden nämlich „eine Pflanzengattung, die zu den Kernobstgewächsen in der Familie der Rosengewächse gehört.“ (Wikipedia)
Wir werden sehen, dass es zumindest einen Aspekt gibt, der bei der ethnologischen Feldforschung und bei der Textarbeit im Lektorat eine Rolle spielt. Versprochen!
Feldforschung in der Ethnologie
Ethnologie als Wissenschaft von den fremden Kulturen braucht Instrumente, um etwas über ihren Gegenstand herauszufinden. Schließlich müssen auch Ethnologen Daten erheben, die ausgewertet werden können. Zwar gehen Ethnologen heute nicht mehr zu Pygmäen, Inuit und Aborigines – die Zeit der von der Zivilisation weitestgehend unberührten Kulturen ist vorbei –, aber sie befassen sich noch immer mit Phänomenen, die sie aus ihrer eigenen Kultur nicht kennen.
In der ersten Hochphase der modernen Ethnologie, also mehr oder weniger in den ersten beiden Dritteln des zwanzigsten Jahrhunderts, befasste sich der Ethnologe mit Gemeinschaften von deren innerstem Gefüge er schlichtweg nichts wusste. Er stürzte sich ins zutiefst Unbekannte. Wer im Fach ernst genommen werden wollte, musste eine längere Zeit bei dem Volk seiner Wahl leben. Darauf legten die Kollegen größten Wert. Derjenige, der diese Fremderfahrung aushielt und mit Informationen heimkehrte, hatte sich die ersten Weihen verdient. Eine solche Feldforschung galt gar als Initiation.
Erwartet wurde, dass der junge Forscher die fremde Sprache erlernte und am Leben des Volkes teilnahm, um den Alltag kennenzulernen und zu begreifen. Die wichtigste Methode der Erforschung dieses Feldes war und ist die sogenannte teilnehmende Beobachtung.
Und dieser Begriff weist schon auf das Kernproblem hin, auf ein Dilemma, in dem sich die Forscher noch heute befinden. Nur, wer teilnimmt, sich orientiert und erste Kontakte knüpft, versteht das fremde Gefügte wenigstens so weit, dass er sich ein Konzept für seine Forschung überlegen kann. Der Ethnologe muss erst mal wissen, wer für was in einer Gemeinschaft zuständig ist, wie man sich annähert, welche Routinen zu beachten sind. Ohne dieses Basiswissen geht gar nichts.
Aber, wer teilnimmt bzw. schon teilgenommen hat, ist bereits Akteur, also Teil des Geschehens. Und diese Innensicht kann nicht mehr abgelegt werden, sie hat den Forscher für immer verändert und sie stört die sachliche Distanz, die vom Wissenschaftler eigentlich erwartet wird. Wer drinsteckt, kann nicht mehr mit dem nötigen Abstand von außen beobachten und beschreiben. Wer schon Leute kennt, einige sympathisch, andere unsympathisch findet, hat sich bereits verortet.
Um es klar zu sagen, dieses Dilemma kann nicht aufgehoben werden, das Problem bleibt bestehen. Bei der Bearbeitung und Auswertung der Daten (Interviews, Gespräche, Beschreibungen usw.) gelingt es, ein wenig abzurücken von dem Persönlichen, etwas Abstand zu gewinnen. Im Umgang mit erhobenen Daten nach festen Kriterien verblasst das subjektive Moment etwas. Außerdem durchläuft eine Veröffentlichung eine strenge Redaktion, denn später wird die wissenschaftliche Community dem Schreiber und damit seinem Institut oder seiner Institution gehörig auf den Zahn fühlen. Trotzdem verhindert das, was die Forschung erst ermöglicht hat, den abgeklärten distanzierten Blick von außen.
Und genau an diesem Punkt lassen sich Äpfel mit Birnen vergleichen.
Die Gratwanderung im Lektorat

Das grundlegende Argument dafür, ein Manuskript ins Lektorat zu geben, ist allseits bekannt. Der Schreiber kennt seine Geschichte in- und auswendig, hat sie mit Herzblut geschrieben. Logikbrüche fallen ihm nicht auf, er weiß ja alles. Formale Fehler überliest er gar. Der Homo Sapiens ist nun mal ein Wesen, dessen Wahrnehmung ganzheitlich ausgerichtet ist. Wir neigen sowieso dazu, Fehler zu überlesen, weil wir unsere Sinne auf das Gesamte ausrichten.
Dies gilt umso mehr, je tiefer man in einer Geschichte drinsteckt.
Genau deshalb ist eine unabhängige Instanz erforderlich, ein Profi-Leser mit Distanz zum Werk, der nach Plot, Anlage der Figuren, Dramaturgie, Spannungsbogen und ganz zuletzt auch nach formalen Fehlern schaut: der Lektor. Zum Glück leuchtet nicht nur mir das ein, sondern auch vielen Autoren.
Mit den besten Absichten und professioneller Distanz lege ich los, lese beispielsweise ein Manuskript von Judith M. Brivulet aus dem Tiranorg-Epos. Drei Bände sind bisher veröffentlicht. Das Manuskript für den vierten liegt auf meiner Festplatte. Ich lese und prüfe, ich verbessere und kommentiere …
Irgendwann ist es so weit: ich begleite die Heldin, ich leide mit Esmanté d‘Elestre und hoffe inständig, dass sie der Folterkammer der Krähenkönigin und dem Schwarzmagier Aonghas entkommt.
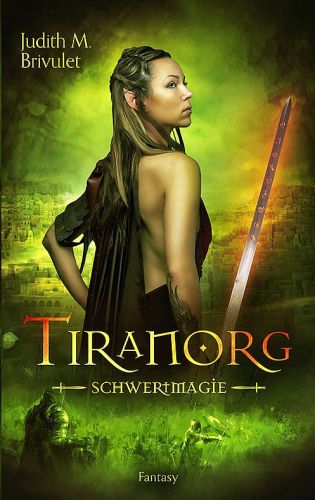
»Lady Esmanté, erinnert Ihr Euch? Mein Name ist Aonghas, Hochmeister Aonghas. Ich gebe Euch ein letztes Mal den Rat: Sagt mir, was ich wissen will. Dann bleiben Euch viele Schmerzen erspart. Der Gute hier ist schon ziemlich wütend, weil er gern wieder mit Euch spielen würde.«
Zur Bestätigung knurrte der Kaven und plusterte die verbliebenen Federn auf.
»Ich weiß nichts.« Mein Hals fühlte sich an, als brauste ein Wüstenwind hindurch.
Eine warme, weiche Hand strich über meine Haare. Ich drehte den Kopf. Das schreckliche Gebiss des Kaven entblößte sich vor mir.
»Zwingt mich nicht, Euch wieder mit ihm allein zu lassen, Meisterin. Dafür schätze ich ein Elfenleben zu sehr. Versteht Ihr nicht, welchen Segen der Orden über das Land bringt? Vergesst für einen Augenblick, was Euer Gefährte Euch erzählt hat. All das Blutvergießen muss nicht sein.«
Ich möchte mein Schwert ziehen und es Aonghas in den Hals rammen. Als Esmanté mit letzter Kraft und einem unbändigen Willen flieht, fange ich an zu schwitzen.
Das Messer herausziehen und mich umdrehen, geschah gleichzeitig, wenn auch nicht so schnell wie sonst.
Die zweite Wächterin schrie wie am Spieß, denn die Fackel hatte ihren Rock in Brand gesetzt. Trotzdem hob sie die Lanze und stach nach mir. Erst im letzten Moment konnte ich ausweichen. Verflucht, war ich langsam! Instinktiv warf ich mich herum. Die Lanze verfehlte mich um Haaresbreite. Die Kavan geriet aus dem Gleichgewicht, wälzte sich am Boden, um die Flammen zu ersticken. Verdammtes Weibsstück. Mit letzter Kraft warf ich mich auf sie. Das Messer war glitschig vom Blut der ersten Vogelfrau, ich rutschte ab …
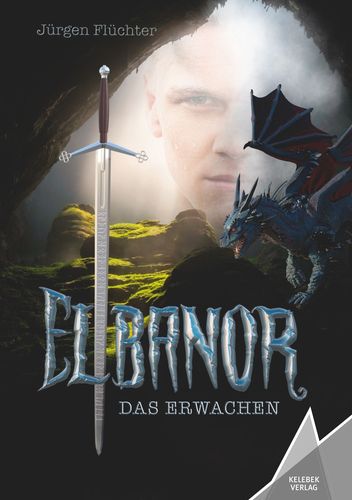
Genauso atemlos bete ich, dass Will und seine Gefährten ihren Verfolgern entkommen. Sie befinden sich in der Parallelwelt Elbanor und sind in eine Sackgasse geraten. Meine Hoffnung schwindet. Ich bin ganz bei Will, dem vierzehnjährigen Helden, der gerade anfing, zu begreifen, dass er weit mehr ist als ein durchschnittlicher Gymnasiast.
Um vier Uhr, schneller als gedacht, standen wir am Abgrund und schauten auf den Fluss, der sich tosend in die Tiefe stürzte. Weit unten bildete er einen wilden, aufgeschäumten See. Wie kochendes Wasser, dachte ich. Ob man einen Sprung überleben würde? Wahrscheinlich nicht. Hundert Meter waren zu viel. Selbst, wenn man dabei nicht draufging, würden die Wassermassen einen sofort in die Tiefe drücken. Hier ging es also zu Ende. (…)
Ich stellte mich neben Tewen, der mir ernst zunickte. Hadburga und Gerald gesellten sich zu uns. Ellanda starrte uns an, wirkte müde und resigniert. Dann steckte sie das Schwert in die Scheide. „Es soll wohl so sein“, sagte sie tonlos.
Wir alle drehten uns mit dem Rücken zum Rand der Klippe, um auf die Fremden zu warten. Ich stand neben Hadburga. Vor dem Sprung würde ich ihre Hand nehmen. Dann kamen sie. Außerhalb der Reichweite unserer Pfeile und der Armbrüste hielten sie an. (…)
Als die Fremden mit erhobenen Schwertern, Äxten, Hämmern und Speeren auf uns zustürmten, brüllend, die Zähne gefletscht wie wilde Tiere, drehten wir uns um und liefen auf den Abgrund zu. Viereinhalb Sekunden …
Äpfel und Birnen
Um es ganz deutlich zu sagen: Streckenweise geht die Distanz flöten. Als Lektorin bin ich nach mehrmaligem Eintauchen in eine Geschichte in einer Situation, die der des ethnologischen Feldforschers ähnelt. Ich bin in das innerste Gefüge vorgedrungen und das, was ich dort erlebt habe, begleitet mich. Anders gewendet: Auch die Lektorin ist ein Stück weit betriebsblind geworden.
Zu meiner Verteidigung kann ich hervorbringen, dass ich nur durch dieses Eintauchen den innersten Kern begreifen kann. Genau diese Innensicht brauche ich, um den Plot und die Essenz des Werkes zu erfassen. Um dann aber noch einmal nach Logikbrüchen und später nach formalen Fehlern zu schauen, benötige ich eine distanzierte Haltung.
Natürlich wird mein Blick klarer, nachdem ich mich beruhigt habe. Mit ein wenig Abstand, einer Portion Selbstdisziplin und Herrn Duden kann ich weiterarbeiten. Aber meine Sicht auf den Text, meine Haltung zur Geschichte ist nach dem Betreten des innersten Gefüges für immer gefärbt. Das ist der Preis.
Zitierte Literatur
Brivulet, Judith M. (2019): Tiranorg – Schwertmagie. Selfpublishing. Band 2 der Tiranorg‑Quadrologie.
Flüchter, Jürgen (2020): Elbanor – die Suche. Kelebek-Verlag. Band 2 der Elbanor‑Trilogie.
